



Briefe, Bilder, Bücher – zu Besuch beim alten Gleim 08.03.2016
Halberstadt,
das
Tor
zum
Harz:
Ein
beeindruckender
Dom
mit
zwei
wuchtigen
Türmen,
die
schon
aus
weiter
Ferne
zu
sehen
sind.
Der
Platz
vor
dem
Gotteshaus,
größer
als
ein
Fußballfeld
und
gegenüber
die
Liebfrauenkirche
mit
vier
weiteren
Türmen.
Auf
diesem
Platz
ein
Mal
im
Jahr
„Ton
am
Dom“
und
hinter
diesem
beeindruckenden
Ensemble,
die
historische
Altstadt
mit
ihren
vielen
Fachwerkhäusern.
Nicht
zu
vergessen,
die
Stadtkirche
St.
Martini,
inklusive
zwei
weiterer
Türme,
dazu
der
Fisch-
und
der
Holzmarkt.
In
der
Altstadt,
auf
einem
Hinterhof,
das
Schraube-Museum,
das
mit
Schrauben
nichts
zu
tun
hat,
um
die
Ecke
das
Papermoon
und
in
der
Nähe
das
einmalige
Cage-Projekt,
dessen
Klang
uns
alle
Jahrhunderte
überdauern
wird.
Es
gibt
ein
Theater,
es
gibt
Kino,
Schwimmhalle
und
Schienen
für
die
Straßenbahn,
die
an
weiteren
alten
Kirchen
der
Stadt
vorüber
fährt.
Wie
viele
Kirchtürme
ragen
in
Halberstadt
eigentlich
gen
Himmel?
Neben
dem
Dom
behütet
das
Gleimhaus
die
Sammlung
vom
alten
Gleim
und
auf
der
Höhe
von
Spiegelsberge
hat
jemand
ein
Riesenweinfass
ohne
Wein
versteckt.
Dort
steht
auch
der
Bismarckturm
und
ihm
zu
Füßen
ein
kleiner
feiner
Tierpark.
Das
alles
plus
vieler
grüner
Flecken
und
noch
einiges
mehr
ist
Halberstadt
aus
der
noch
engen
Sicht
eines
Neulings.
So
viel,
wie
ich
aufgezählt
habe,
so
viel habe ich sicher auch vergessen, zu nennen.
Kaum
zu
glauben,
aber
von
all
dem
wusste
ich
bis
vor
zwei
Jahren
nichts,
gar
nichts.
Für
mich
war
die
Stadt
identisch
mit
Würstchen.
Nicht
einmal
die
Nähe
zum
Harz
war
mir
wirklich
bewusst
und
dass
auf
halber
Strecke
zwischen
beiden
die
alte
Burg
Regenstein
aus
der
Landschaft
ragt,
auch
nicht
wirklich,
obwohl
ich
dort
oben
schon
einmal
als
Kind
mit
meinen
Eltern
stand.
Halberstadt
ist
von
Elsterwerda,
von
wo
ich
herkam,
weit
entfernt
und,
im
Vergleich
zu
Goslar,
in
meinem
Bewusstsein auch nie ein mögliches Reiseziel gewesen.
Inzwischen
bin
ich,
seit
dem
1.
September
2014,
ein
Neu-Halberstädter
und
glücklich,
hier
gestrandet
zu
sein.
Weil
ich
so
wenig
von
diesem
Flecken
wusste,
gibt
es
für
mich
hier
auch
so
viel
zu
entdecken.
Oder
hätten
Sie,
der
zufällige
Leser,
ad
hoc
gewusst,
wer
Johann
Wilhelm
Ludwig
Gleim
war
und
was
ihn
für
die
deutsche
Literaturforschung
so
interessant
macht?
Ich jedenfalls nicht, aber genau aus diesem Grund habe ich heute eine Verabredung im alten Gleimhaus.
Ich
bin
Kind
eines
Staates,
den
es
nicht
mehr
gibt.
Meine
Eltern
lebten
mir
Achtung,
Offenheit
und
die
Neugier
auf
andere
Menschen
und
deren
Kultur
vor.
Die
umfangreiche
Korrespondenz
meines
Vaters
wies
mir
gedankliche
Wege
über
Grenzen
in
die
weite
Welt.
Er
war
es,
der
seinem
Sohn
ermöglichte,
in
diesem
Umfeld
seit
1971
eine
intensive
Brieffreundschaft
nach
Schottland
zu
pflegen
und
die
Liebe
zur
Rockmusik
auszuleben,
die
über
alle
Grenzen
hinweg
die
Herzen
einer
damals
jungen
Generation
im
Sturm
eroberte
und
ihr
Denken
revolutionierte.
Insgesamt
zehn
dicke
Ordner
Briefverkehr
und
eine
beachtliche
Sammlung
Vinyl
kamen
so
zusammen.
Ich
lernte
Judy
aus
Tasmanien,
Susanne
aus
dem
Schwäbischen
und
mit
ihnen
die
Einsicht
kennen,
dass
Freundschaft,
neben
dem
eigenen
Leben
und
der
Liebe,
das
höchste
Gut
ist,
das
man
geschenkt
bekommen
kann.
Was
nützen
digitale
Häkchen,
ein
„gefällt
mir“
und
die
Ansammlung
von
zweihundert
„Freunden“,
wenn
ich
in
der
Euphorie
der
Freude
oder
im
Schmerz
niemanden
habe,
der
bereit
ist,
das
Gefühl
mit
mir
auszuleben
und
den
Moment
zu
teilen,
der
an
meine
Tür
klopft
und
einfach
da
ist.
Ich
bin
einer,
der,
bei
all
den
Vorteilen
der
digitalen
Vernetzung,
noch
immer
analog
und
warm
denkt,
um
im
Kontext
der
Musik
zu
bleiben.
Die
Aussicht,
auf
jemanden
mit
ähnlichen
Intentionen,
wenn
auch
aus
einer
früheren
Zeit
kommend,
zu
treffen,
hat
die
Neugier
in
mir
geweckt.
Hinter
dem
gotischen
Dom
führt
eine
alte
holprige
Pflastersteinstraße
herum,
an
einem
Fachwerkhaus
vorüber.
Hier
lebte
bis
1803
der
Dichter,
Jurist
und
Literaturliebhaber,
der
Meister
im
Briefeschreiben
und
im
Netzwerke
verknüpfen
-
Johann
Wilhelm
Ludwig
Gleim.
Hier
befinden
sich
seine
umfangreiche
Sammlung
von
Büchern
und
die
Porträts
von
Zeitgenossen,
mit
denen
er
regelmäßig
Kontakte
pflegte
und
Gedanken
tauschte.
Für
die
Nachwelt
zum
Bestaunen,
für
die
Wissenschaft
ein
Forschungsobjekt.
Geht
man
auf
den
Pflastersteinen
um
den
Dom
herum,
meint
man,
Geschichte
und
ihre
Geschichten
förmlich
fühlen
zu
können.
Die
Schritte
werden
kleiner
und
dann
stehe
ich
vor
dem
Gleimhaus,
hinter
dessen
schlichtem
Fachwerk
sich
ein
Fundus
verbirgt,
den
man
dem
Häuschen
und
der
Stadt,
wo
es
steht,
eigentlich
nicht
zutraut.
Doch
was
macht
den
alten
Herrn
Gleim,
von
dem
ich
bisher
nie
etwas
gehört
hatte,
so
interessant
und
so
faszinierend
für
Menschen
unserer Tage?
Dem
historischen
Gleimhaus
ist
ein
modernes
Museumsgebäude
hinzugefügt.
Der
erste
Neubau
seiner
Art
und
in
Deutschland
nach
der
politischen
Wende.
Viel
Glas,
viel
Licht
und
viel
Offenheit.
Ein
Symbol
oder
Zufall?
Ich
entscheide
mich
für
das
Symbolhafte,
für
ein
Gefühl,
das
ich
hier
bei
Konzerten
schon
mehrmals
genießen
durfte.
Diese
Durchsichtigkeit verschließt nicht, sie öffnet das Innere und lockt die Blicke, denen der neugierige Besucher folgen kann.
Hier
im
Foyer
empfängt
mich
eine
dezent
schlicht
gekleidete
Dame:
Anna
Louisa
Karsch.
Nicht
aus
der
Mitte
des
Raumes,
sondern
behutsam
von
der
Seite
her
leitet
sie
mich
hinein
in
eine
Zeit,
die
auch
die
ihre
war,
denn
sie
ist
eine
aus
dem
Freundeskreis von Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
Und
dann
sitze
ich,
inmitten
der
schöpferischen
Unruhe
eines
modernen
Arbeitszimmers,
lausche
den
Worten
und
staune,
wir
nah
mir
die
Botschaften
und
wie
eng
die
Parallelen
eigentlich
sind.
Das
hatte
ich
nicht
erwartet.
Beinahe
jedem
Wort
und
jedem
neuen
Detail
folgt
die
Erkenntnis,
dass
ich
diesem
Gleim
schon
viel
früher
hätte
begegnen
sollen
oder
gar
etwas
von
ihm
auch
in
mir
verborgen
ist.
Für
Momente
ist
mir,
als
säße
dieser
Typ
spitzbübisch
grinsend
neben
mir
am
Tisch,
als
wollte er sagen: „Siehst’e, wusste ich’s doch!“.
Im
November
1747
verschlägt
es
den
jungen
Gleim,
der
in
Halle
studiert
und
danach
in
Potsdam
und
Berlin
gelebt
hatte,
von
da
zurück
nach
Halberstadt.
Knapp
dreißig
Jahre
alt,
lässt
er
Freunde
und
eine
bis
dahin
gewohnte
Umgebung
zurück,
um
in
Halberstadt
fortan
als
Domsekretär
zu
wirken
und
sein
Leben
zu
gestalten.
Ich
stelle
mir
mit
heutiger
Sichtweise
vor,
wie
frustrierend
es
gewesen
sein
muss,
zwischen
sich
und
Freunden
beschwerliche
Tagesreisen
zu
wissen,
keine
Möglichkeiten
für
die
bisher
bewährten
Geselligkeiten
zu
haben.
Obwohl
im
Harz
geboren,
muss
die
Rückkehr
hierher
dennoch ein gewaltiger Einschnitt gewesen sein.
Doch
ein
überdurchschnittliches
Einkommen
verhilft
ihm,
eine
Idee
zu
verwirklichen.
Der
junge
Gleim
richtet
sich
ein
„Zimmer
der
Freundschaft“,
seinen
kleinen
privaten
„Tempel
der
Verdienstvollen“,
ein.
Er
lässt
von
bedeutenden
Malern
seiner
Zeit
Porträts
von
Freunden
malen
und
alle
in
gleicher
Größe,
denn,
ganz
im
Sinne
der
Aufklärung,
sind
alle
gleich,
unabhängig
vom
ihrem
Stand
und
der
Herkunft.
Na
und,
könnte
jetzt
jemand
vorschnell
sagen,
aber
in
jenen
Tagen
ist
dieser
Gedanke
eine
kleine
Revolution,
über
deren
Wirken
wir
in
der
Schule
ganze
Aufsätze
schrieben.
Während
ich
neugierig
zuhöre,
ich
mir
vorstelle,
wie
ein
Porträt
nach
dem
anderen
entstand,
versucht
mein
zweites
Ich
sein
Wissen
über
die
Aufklärung
zu
reaktivieren.
Könnte
es
sein,
dass
unsere
Gesellschaft,
so
aufgeklärt,
wie
sie
sich
nach
außen
gerade
gibt,
dringend
so
etwas
wie
Aufklärung,
eine
neue
Bewegung
„alle
sind
wir
gleich“,
gebrauchen
könnte?
Völlig
unabhängig
von
unserer
Herkunft
und
unserer
Position
in
der
Gesellschaft,
unabhängig
davon,
welchem
Gott
wir
huldigen
und
welche
Hautfarbe die Natur uns gab?
Das
Haus
hat
einen
kleinen
engen
Innenhof.
Hier
ist
es
hell
und,
der
Jahres-
und
Tageszeit
gemäß,
ziemlich
frisch.
Der
Zwischenstopp
tut
gut,
schafft
Freiheit
im
Kopf
und
kühlt
die
Gedankenhatz
darin
ein
wenig
auf
Normaltemperatur
herunter.
Einige
merkwürdige
Gefäße,
unter
Hockern
stehend,
ziehen
die
Aufmerksamt
auf
sich
und
schnell
erkennt
der
Betrachter,
dass
dies
wohl
steinerne
Urnen
sind.
Da
drängt
sich
die
Frage
nach
dem
Warum
auf.
Ich
erfahre
vom
„Poetengang“
in
Halberstadt
und
was
es
damit
auf
sich
hat.
Der
Neu-Halberstädter
in
mir
hat
ein
neues
Ziel,
ein
weiteres
Objekt
der
Begierde, entdeckt.
Johann
Wilhelm
Ludwig
Gleim,
so
erfahre
ich,
suchte
und
fand
im
Laufe
seines
Lebens
brieflichen
und
direkten
Kontakt
zu
mehr
als
400
Freunden:
Literaten,
Dichter,
Politiker
und
andere
Zeitgenossen.
Von
so
einem
Freundes-
und
Bekanntenkreis
träumt
heutzutage
manch
Facebook-Jünger.
Und
doch
gelang
es
Gleim,
dieses
Netzwerk
der
Freundschaft,
brieflich
und
alles
per
Hand
geschrieben,
aufzubauen
und
mit
Leben
zu
erfüllen.
Nicht
vom
Smartphon
mal
schnell
eine
Kurznachricht
versendet,
sondern
jeden
Brief,
Wort
für
Wort,
einschließlich
Groß-
und
Kleinschreibung,
mit
Federkiel
von
Hand
geschrieben.
Man
stelle
sich
die
Zeit
und
die
Mühe
vor,
die
es
braucht,
nur
ein
einziges
Blatt
Papier
mit
der
eigenen
Handschrift
zu
beschreiben!
Bei
mir
im
Regal
stehen
insgesamt
zehn
Ordner,
in
denen
meine
gesamte
Korrespondenz,
mit
Schreibmaschine
geschrieben,
aus
nur
drei
Jahrzehnten
mit
meinem
schottischen
Freund
gebündelt
ist.
Dieser
Gleim
muss
wahrlich
ein
vom
Schreiben
Besessener
gewesen
sein.
Etwa
10.000
seiner
Briefe
sind
uns
erhalten
geblieben,
die
alle
im
Gleimhaus
aufbewahrt
sind.
Was
heute
über
die
drei
großen
B’s
–
Briefe,
Bilder,
Bücher
–
hinaus
wirkt,
ist
sein
Bemühen,
sein
geschaffenes
Netzwerk
zu
nutzen,
um
Schwächeren
zu
helfen
oder
Begabte
zu
fördern.
Die
Dame
im
Foyer,
Anna
Louisa
Karsch,
ist
dafür
ein
Beispiel
von
vielen.
Doch
das
ist
schon
wieder
ein
anderer
interessanter
Stoff
für
ein
neues
Thema
Seit
meiner
Jugend
bin
ich
leidenschaftlicher
Schallplattensammler.
Hinter
so
manch
schwarzem
Vinyl
verbirgt
sich
bei
mir
eine
sehr
persönliche
und
manchmal
auch
skurrile
Geschichte.
Wenn
jede
meiner
weit
über
tausend
Platten
erzählen
könnte!
Da
stehe
ich
nun
zwischen
den
hoch
aufragenden
Regalen
im
Hause
von
Gleim
und
die
sind
bis
unter
die
Decke
voll
mit
Büchern.
Es
müssen
zehntausende
sein,
die
mich
in
diesem
Moment
zu
Staunen
bringen.
Für
einen
winzigen
Moment
stelle
ich
mir
vor,
dies
wären
alles
Schallplatten!
Nein,
ich
bin
nicht
neidisch,
nur
ein
moderner
Jäger
und
Sammler,
einer
der
noch
viele
Wünsche
offen
hat
und
plötzlich
vor
einer
Sammlung
steht,
die
vollkommen
und
komplett
scheint.
Für
den
Augenblick
werden
mir
die
Knie
weich
und
dann
realisiere
ich,
dass
in
diesen
Regalen
das
niedergeschriebene
Archiv
einer
ganzen
Epoche
vereint
ist
und
in
meinem
Kopfkino
sehe
ich
eine
Bibliothek
wie
die
aus
„Der
Name
der
Rose“
und
dann,
wie
eine
vom
Glaube
blinde
Horte,
die
Tempel,
Statuen
und
Schriften
einer
Jahrtausende
alten
Kultur
in
die
Luft
jagt.
Einfach
nur
so.
Wozu
Menschen
doch
fähig
sind,
im
Großartigen,
wie
im
Abscheulichen.
Wir
müssen
noch
viel
lernen,
wenn
wir leben wollen!
Bei
dieser
Kommunikationsfreude
blieb
es
nicht
aus,
dass
so
mancher
Zeitgenosse
sich
selbst
gern
in
der
Porträtsammlung
von
Gleim,
neben
Herder,
Lessing,
Klopstock,
Jean
Paul
oder
gar
Friedrich
II.
von
Preußen
an
der
Wand
sehen
wollte.
Man
wollte
dazu
gehören,
Teil
des
Freundeskreises
und
damit
ein
Teil
der
geistigen
Elite
sein.
Man
fühlte
sich
geschmeichelt,
obwohl
die
Vorgabe,
beim
Malen
den
Stand
außen
vor
zu
lassen
und
alle
gleich
darzustellen,
durchaus
nicht
der
Zeit
gemäß
schien,
sondern
ihr
voraus
war.
Solche
Gedanken
drängen
sich
mir
auf,
während
ich
über
die
schrägen
Fußböden
jene
Zimmer
durchschreite,
in
denen
heutzutage
rund
140
Porträts
zu
bestaunen
sind.
Was
man
hier
sehen
kann,
ist
nichts
weniger
als
der
umfangreichste
zusammenhängende
und
bestens
erhaltene
Nachlass
eines
deutschen
Dichters
des
18.
Jahrhunderts,
am
seinem
ursprünglichen
Sammelort
aufbewahrt
und
den
persönlichen
Intentionen
desjenigen
folgend.
Beim
Nachfragen
erfahre
ich,
dass
einige
der
Stücke
in
den
Wirren
der
letzten
Kriegstage
in
Richtung
Osten
abtransportiert
und
in
Zeiten
der
Perestroika
wieder
zurück
gebracht
wurden.
Viele
andere
werden
dort
noch
vermutet.
Doch
in
heutigen
Tagen,
fünfundzwanzig
Jahre
nach
dem
Fall
der
Mauer
und
dem
Zerfall
der
Sowjetunion,
scheint
eine
solche
neue
Geste
weiter entfernt, denn je. Wir müssen noch sehr viel lernen!
Das
Gleimhaus
in
Halberstadt
ist
ein
Museum.
Man
kann
hinein
und
durch
die
Räume
gehen,
so
wie
in
jedem
anderen
Museum
auch.
Es
gibt
viel
zu
sehen,
manch
interessantes
Detail
zu
entdecken
und,
wer
ein
Auge
dafür
hat,
kann
auch
einen
Blick
in
die
Zeit
riskieren.
Dennoch,
so
mein
Eindruck,
ist
hier
einiges
anders,
denn
im
Haus
Gleim
läuft
man
Gefahr,
sich
selbst
neu
zu
entdecken.
Mal
ganz
ehrlich,
wann
haben
Sie
sich
zum
letzten
Mal
Zeit
genommen,
einen
Brief
von
Hand
zu
schreiben?
Haben
Sie
Briefe
Ihrer
Eltern,
Geschwister,
Kinder
oder
von
Freunden
aufgehoben?
Beim
Bestaunen
der
Bücher
wurde
ich
auf
mehrere
dicke
Wälzer
hingewiesen,
die
sich
als
Herbarien
entpuppten
und
mir
fiel
ein,
dass
so
ein
Hefter
aus
meiner
Penne-Zeit
auch
noch
bei
mir
zu
finden
ist.
Die
Beschriftung
darin,
man
höre
und
staune,
erfolgte
noch
mit
einem
Füllfederhalter
und
meine
Schrift
hatte
damals
schon
richtig
Charakter.
Heute
schreibe
ich,
falls
es
einmal
notwenig ist, mit Kugelschreiber und einer Handschrift, die ein wenig aus der Übung gekommen scheint. Leider!
Mich
fasziniert
dieses
Schreibpult
von
Gleim.
Ein
Möbelstück,
Kombination
zwischen
Schulbank
und
Sessel,
das
geradezu
zum
Schreiben
lockt
und
verleitet.
Ich
hätte
nicht
schlecht
Lust,
mir
ebenfalls
so
ein
Möbelstück
hinzustellen,
wären
da
nicht
die
Kosten
für
ein
weiteres
Unikat.
Die
Schreibfläche
ist
verstellbar,
in
den
Armlehnen
verbergen
sich
kleine
Fächer
und wenn man sich anders herum darauf setzt, befindet man sich in einem Sessel. Ein guter Platz zum Denken.
Vielleicht,
so
eine
nicht
ganz
ernst
gemeinte
Vermutung,
hat
Mark
Zuckerberg
sich
Inspirationen
bei
Gleim
geholt,
als
über
die
Komponenten
für
Facebook
nachdachte:
Wir
kennen
die
Profilbilder,
wie
die
Porträts
von
Gleim.
Wir
haben
solche
Bilder
vor
unseren
Augen,
wenn
wir
entweder
eine
persönliche
Nachricht
oder
einen
neuen
Text
schreiben.
Wir
vernetzen
uns
untereinander,
wir
senden
Bilder
und
Informationen,
wir
bilden
neue
Gruppen
und
ein
jeder
versucht,
für
andere
interessant
zu
sein.
So
wie
es
bereits
Gleim
mit
seinen
Mitteln
in
seiner
Zeit
tat.
Damals
wie
heute
geht
es
um
Kommunikation,
um
Darstellung
und
Übermittlung.
Von
einem
wie
Johann
Wilhelm
Ludwig
Gleim
können
wir
zusätzlich
lernen,
mit
all
dem
Gutes
und
Sinnvolles
zu
tun.
Dann
wäre
wieder
ein
kleiner
Teil
unseres
Daseins
ein
wenig
besser,
als
am
Tag zuvor. Ein jeder von uns, jeden neuen Tag, ein klein wenig wie Gleim sein.



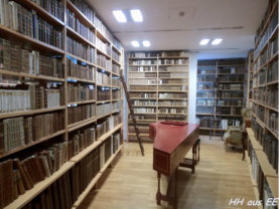
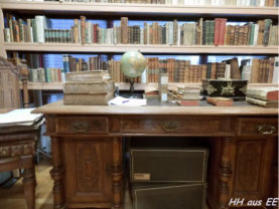









Ich bin der RockRentner im Harz
und berichte hier von meinen Wanderungen, zufälligen Begegnungen und Entdeckungen im Harz.



- Gewitter-Tour am Kahleberg
- Flossfahrt auf dem Stausee
- Auf dem Weg zur Plessenburg
- Von Bad Harzburg nach Ilsenburg
- Rundwanderweg Torfhausmoor
- KlippenTour - die Zweite
- Barenberg & Schnarcherklippen
- Scharfensteinklippe am Brocken
- Elversstein und Steinbergkopf
- Im Saneltal zur Mönchsbuche
- Märzbecher & Gegensteine
- Meine Klippen-Tour
- Blauer See in Grün
- Endlich Schnee!


- Hochwasser an der Ilse
- Ilsestein und Paternosterklippe
- Durchs Ilsetal zum Kruzifix
- Sudmerberger Warte Goslar
- Wandern um den Oderteich
- Durchs Ilsetal zur Stempelsbuche
- Aufstieg zum Froschfelsen
- Tagestrip zur Steinernen Renne
- Auf den Rammelsberg gestiegen
- Eckerlochstieg & Ahrensklint
- Aufstieg zur Leistenklippe
- Kapitelsberg bei Tanne
- Begegnungen am Trudenstein
- Eckertalsperre mit Brockensicht
- Wandern zum Volkmarskeller
- Am Steinberg(Turm) von Goslar
- Wildkatzen-Erlebniszentrum Harz
- Teufelsmauer & Mühle bei Warnstedt
- Mittelalterspiele zu Ostern
- Waldgeschichten - die Trilogie
- Schneewandern im Hochharz
- Am Granestausee bei Goslar


- Wandern im herbstlichen Ilsetal
- Wandern zur Achtermannshöhe
- 1. Inselurlaub auf Poel
- 2. Poel: See-Pferde & Drachen
- 3. Poel: Fern-See-Gucker
- 4. Poel: Steilküste & Strandbude
- 5. Poel: Segel am Horizont
- 6. Poel: Pjotr Kschentz & Abschied
- Rabenklippe mit Luchsgehege
- Wilhelmshöhe & Sonnenklippe
- Die Gegensteine der Teufelsmauer
- Krähenhütte und Fuchsklippe
- Im Bodetal zum Bodekessel
- Mohnfeld im Spätling
- Stufenweise zum Gläsernen Mönch
- Dreieckiger Pfahl & Eckersprung
- Im Elendstal & auf Helenenruh
- Miniaturpark Wernigerode
- Ausblick vom Großen Thekenberg
- Wandern zu den Hahnenkleeklippen
- Großvaterfelsen Blankenburg
- Armeleuteberg Wernigerode
- Bärlauch & russische Lieder
- Stapelburg und Jungborn


- Operation Edelstahl
- Kamelfelsen Westerhausen
- Im Spargelhof Klaistow
- Episoden in Nürnberg
- Baumwipfelpfad Bad Harzburg
- Am Anhaltinischen Saalstein
- Preußenturm Bad Suderode
- Spaß im Abenteuerland
- Wohnfass in Seeburg
- Am Hamburger Wappen
- Luisenburg & Schloss Blankengurg
- Königsburg & Trogfurther Brücke
- Verschwitzt an der Wolfswarte
- Auf dem Agnesberg Wernigerode
- Gelbe Rapsfelder am Huy
- Familie Stieglitz
- Querfeldein zum Peterstein
- Auf und Ab zur Jungfernklippe
- Ein anderer Valentinstag
- Schloss Wernigerode im Winter
- Blauer See im Schnee


- Borkum an der Nordsee
- Pippi Langstrumpf in Thale
- Ton am Dom 2019
- Ritterspiele auf Burg Regenstein
- Landschaftspark Degenershausen
- 1. Urlaub auf Poel
- 2. Am Schwarzen Busch
- 3. Peter Pjotr Kschentz
- 4. Badestrand & Timmendorf
- 5. Hansestadt Wismar
- 6. Wind & Wellen
- 7. Pilgern auf Poel
- Nahaufnahmen
- Harztour mit Freunden


- Atelier am Stadtrand
- Herbstwanderung
- Entdeckungen am Regenstein
- Rosstrappe im Herbst
- Schraube-Museum Halberstadt
- Brockentest mit Lily
- Ton am Dom 2015
- Cage-Projekt
- Hextentanzplatz
- Sonnenfinsternis 2015
- Rosstrappe per Sessel-Lift
- Lily liebt Schnee
- Turmblasen vom Dom
- Erntedank & Felswohnungen
- Hinterm Zaun














